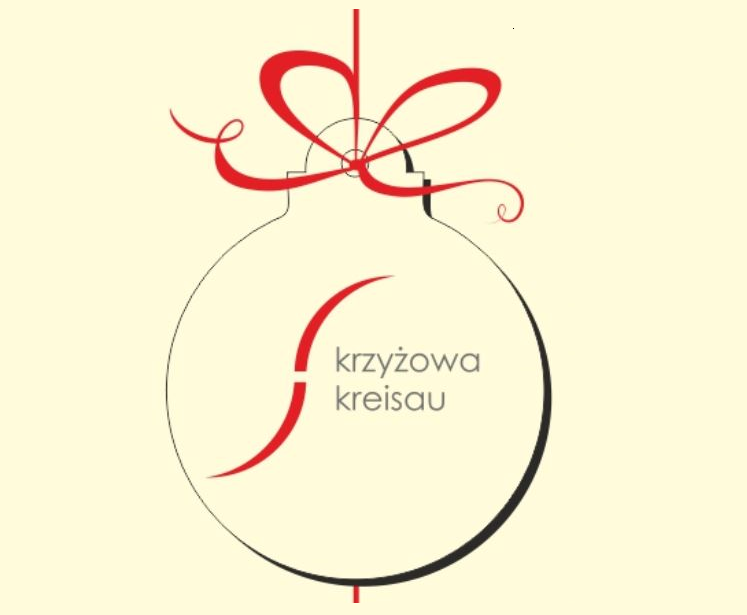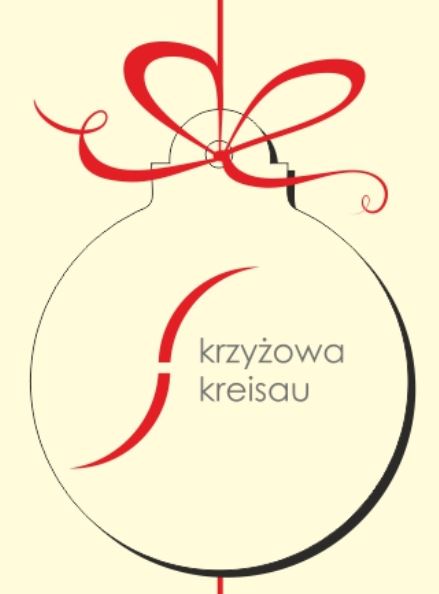Die Klimakrise wie auch die Degradierung der Umwelt gehören zu den größten Herausforderungen der Menschheit im 21. Jahrhundert. Das Paradigma des Wirtschaftswachstums um jeden Preis, der Geist des Konsumismus sowie Grundeinstellungen, die von Gier und Ausbeutung zeugen - prägend für das Verhältnis des Menschen zur Erde, zu ihren Ressourcen wie auch zu allen Benachteiligten und Schwachen - haben das ökologische Gleichgewicht ins Wanken gebracht und zur Degradierung der Umwelt, zu sozialen Ungleichheiten sowie zu Klimaveränderungen geführt.
Die fortschreitenden Folgen des Klimawandels können wir auf der ganzen Welt beobachten und spüren sie auch hier, auf unserem Teil Europas: immer wärmere Winter, zunehmende Dürre, extreme Wetterereignisse wie z.B. heftige Regenfälle, die immer häufiger auftreten.
Weiterlesen: Klimakrise – was können wir tun? || Anna Dańkowska

Wie sollte sich die Stiftung Kreisau in Angesicht der Klimakrise, der Degradierung der natürlichen Umwelt und der immer gravierenderen sozio-ökonomischen Probleme verhalten? Die Aufgabe der Stiftung liegt unserer Meinung nach vor allem darin, mutige Fragen zu stellen, die Ausbeutung der Erde und ihrer Bewohner*innen kritisch zu hinterfragen, nach konstruktiven Lösungsansätzen für eine bessere Zukunft zu suchen sowie Denkweisen zu fördern, die von Respekt für die Umwelt und ihre Ressourcen sowie von Solidarität für Andere geprägt sind.
Die Stiftung als Ort der Begegnung und Bildung, den jährlich über 10 000 Menschen besuchen, bietet weitreichende Möglichkeiten für die Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen. Gleichzeitig verpflichtet auch ihre Satzung sie dazu: So gehören zu der Stiftungsarbeit u. a. Tätigkeiten, die „Ökologie, Tier- und Naturschutz“ fördern. Der Zweck der Stiftung besteht laut Satzung darin, „Aktivitäten zu initiieren und zu fördern, die auf ein friedliches und von gegenseitiger Toleranz geprägtes Zusammenleben der Völker, Gesellschaftsgruppen und einzelnen Menschen zielen.“ Auch die Klimakrise und die Degradierung der Umwelt stellen in diesem Sinne eine immer stärker werdende Bedrohung für den Frieden dar.
Weiterlesen: Unsere Vision von Nachhaltigkeit in Kreisau || Anna Dańkowska, Robert Żurek
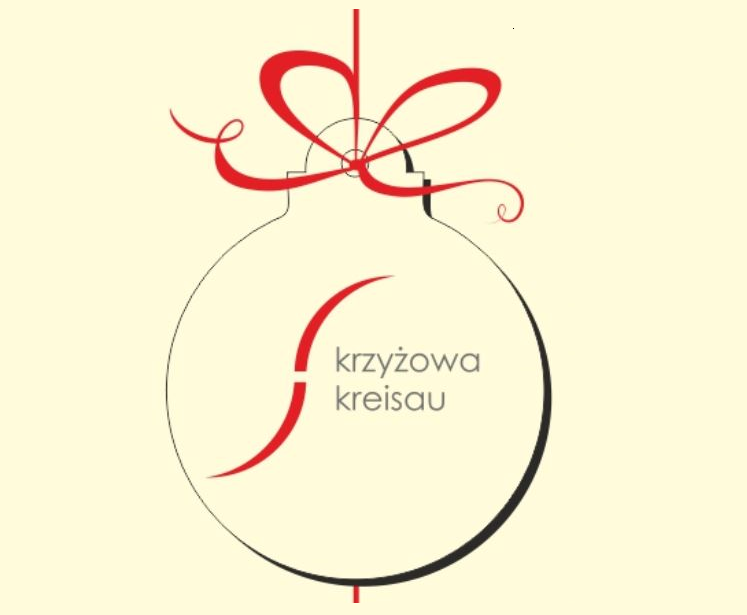
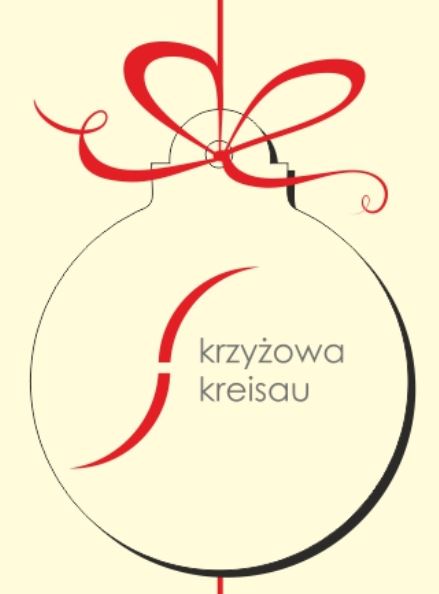 Im Allgemeinen wird bei Eröffnungen ja ein Band durchgeschnitten. Aber wir kamen auf die Idee, dass nicht zerschnitten sondern verbunden wird. Zwei Gruppen von Kindern mit zwei Bändern, in den Farben der beiden Länder, kamen von der Bühne und die beiden Regierungschefs kamen gemeinsam dazu und verknüpften die Bänder mit einem Knoten. Ich denke, dass das ein sehr vielsagender Moment war: Wir fangen an – wir verbinden. Dr. Ewa Unger über die feierliche Einweihung der Begegnungsstätte der Stiftung Kreisau im Jahr 1998.
Im Allgemeinen wird bei Eröffnungen ja ein Band durchgeschnitten. Aber wir kamen auf die Idee, dass nicht zerschnitten sondern verbunden wird. Zwei Gruppen von Kindern mit zwei Bändern, in den Farben der beiden Länder, kamen von der Bühne und die beiden Regierungschefs kamen gemeinsam dazu und verknüpften die Bänder mit einem Knoten. Ich denke, dass das ein sehr vielsagender Moment war: Wir fangen an – wir verbinden. Dr. Ewa Unger über die feierliche Einweihung der Begegnungsstätte der Stiftung Kreisau im Jahr 1998.
In diesem Jahr mussten wir von Dr. Ewa Unger Abschied nehmen – einer der Gründerinnen der Stiftung Kreisau. Ihre Worte können uns Auftrag sein. In einer Zeit in der uns soviel Mutlosigkeit, Ängste und Konflikte umgeben – wollen wir verbinden. Kümmern wir uns um unsere Beziehungen, unterstützen wir uns gegenseitig, schaffen wir einen Raum des Respekts und der Verständigung.
Das wünschen wir Ihnen - unseren Freund*innen und Partner*innen – anläßlich des Weihnachtsfests und des sich nähernden Neuen Jahres.
Vorstand und Mitarbeiter*innen der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung
Weiterlesen: Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021
 Im Rahmen des von der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen durchgeführten Projekts „Dialog- und Versöhnungslabor” wurden zwei Publikationen erstellt:
Im Rahmen des von der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen durchgeführten Projekts „Dialog- und Versöhnungslabor” wurden zwei Publikationen erstellt:
Die erste Veröffentlichung – „Der erste Schritt. Dialog-Workshop-Szenarien“ – soll in erster Linie eine Hilfestellung für diejenigen sein, die am Anfang stehen, die dabei sind, es mal zu versuchen, die noch zögern oder die nach neuen Inspirationen und Ideen für ihre Arbeit mit Jugendlichen suchen.
Die zweite Publikation – „Ein Dialog findet (nicht) statt. Essays” – stellt hingegen nicht nur einen Versuch dar, zu zeigen, wie es um den Dialog in der heutigen Welt bestellt ist, sowie Erfahrungen und Schwierigkeiten zu schildern, auf die diejenigen stoßen können, die sich beruflich mit zivilgesellschaftlicher Bildung befassen. Darüber hinaus regt sie hoffentlich auch dazu an, sich einer Kultur der Polarisierung und des Streits entgegenzustellen.
Weiterlesen: Veröffentlichungen || Workshop-Szenarien sowie Essayband zum Thema Dialog