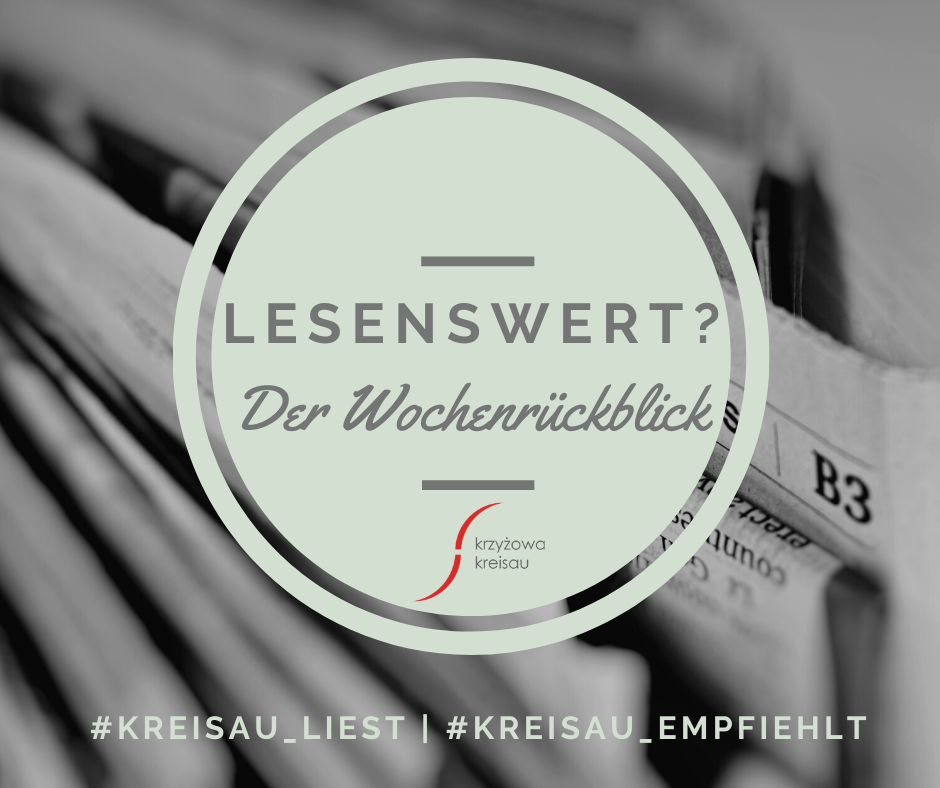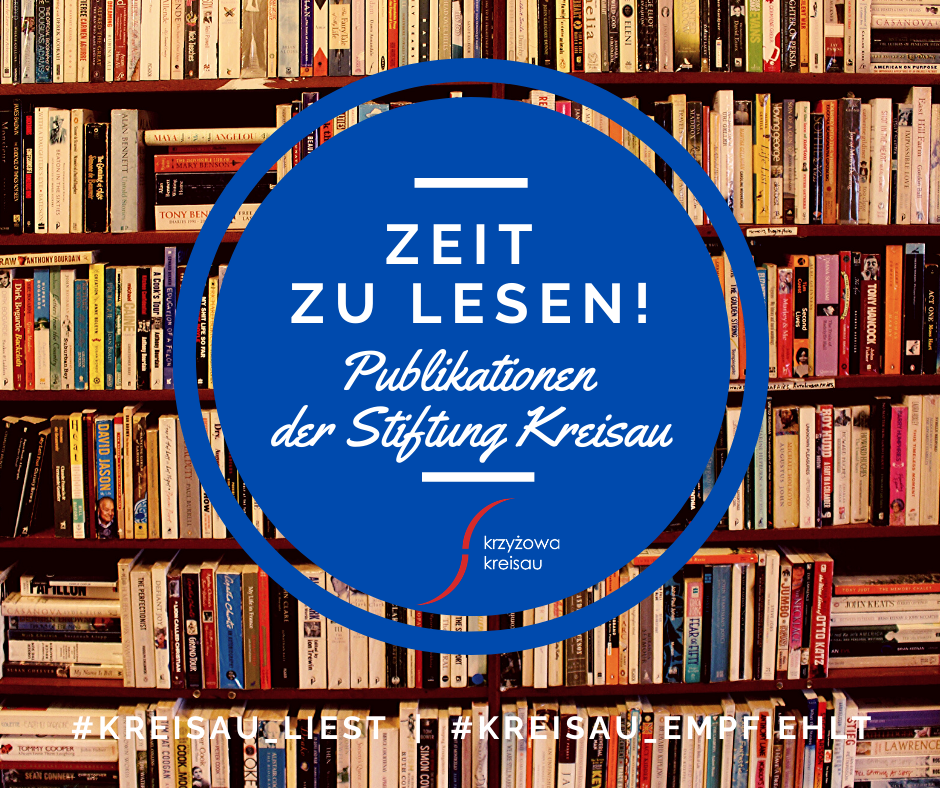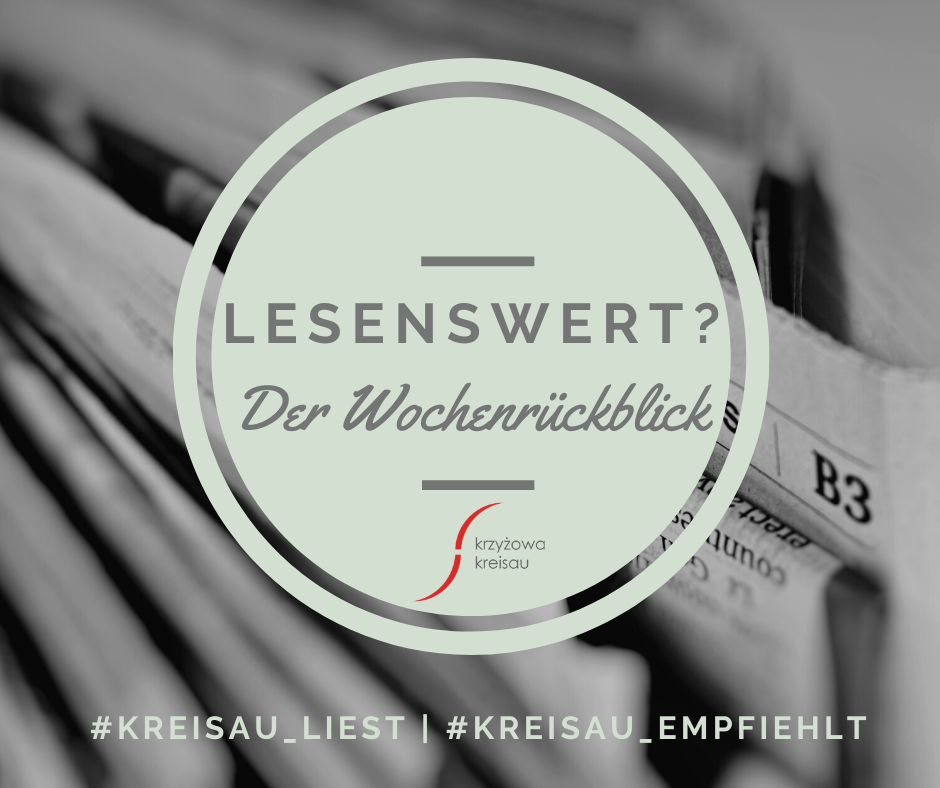 Herzlich laden wir Sie zur Lektüre unserer subjektiven Presseschau ein. Die Artikel sind in den vergangenen Tagen erschienen und wir hoffen, dass sie für Sie interessant oder überraschend sind oder auch zu Diskussion und Widerspruch anregen.
Herzlich laden wir Sie zur Lektüre unserer subjektiven Presseschau ein. Die Artikel sind in den vergangenen Tagen erschienen und wir hoffen, dass sie für Sie interessant oder überraschend sind oder auch zu Diskussion und Widerspruch anregen.
Es geht nicht darum, mit allen versammelten Ansichten übereinzustimmen sondern darum, bewußt wahrzunehmen, wie die uns umgebende Wirklichkeit von anderen gesehen wird. Es lohnt sich, mehr als eine Perspektive zu kennen.
#Kreisau_liest #Kreisau_empfiehl
(…) Am Haus prangt ein Schild mit dem Hinweis "WeiberWirtschaft", darunter steht: "Gründerinnenzentrum". Hier, in Berlin-Mitte, hat das "Centre for Feminist Foreign Policy" seinen Sitz, das Zentrum für feministische Außenpolitik. Kristina Lunz, 30, Mitgründerin und Geschäftsführerin des Zentrums, empfängt im Innenhof des Gebäudes, Corona-konform.
Weiterlesen: Lesenswert. Der Wochenrückblick #15 | #Kreisau_liest #Kreisau_empfiehlt
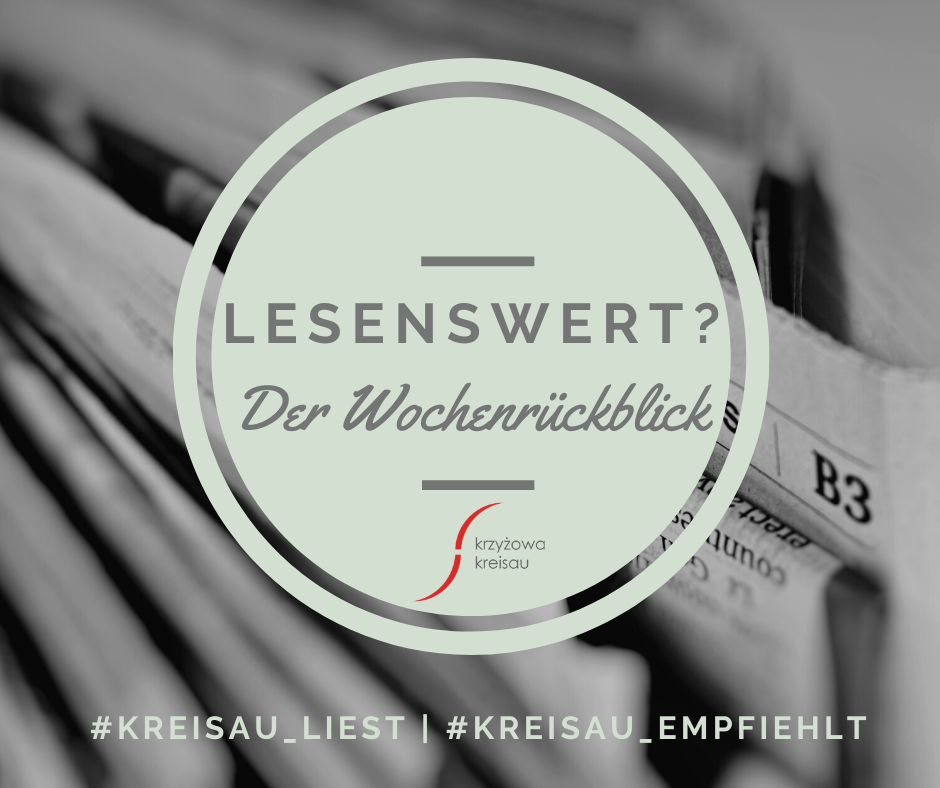 Herzlich laden wir Sie zur Lektüre unserer subjektiven Presseschau ein. Die Artikel sind in den vergangenen Tagen erschienen und wir hoffen, dass sie für Sie interessant oder überraschend sind oder auch zu Diskussion und Widerspruch anregen.
Herzlich laden wir Sie zur Lektüre unserer subjektiven Presseschau ein. Die Artikel sind in den vergangenen Tagen erschienen und wir hoffen, dass sie für Sie interessant oder überraschend sind oder auch zu Diskussion und Widerspruch anregen.
Es geht nicht darum, mit allen versammelten Ansichten übereinzustimmen sondern darum, bewußt wahrzunehmen, wie die uns umgebende Wirklichkeit von anderen gesehen wird. Es lohnt sich, mehr als eine Perspektive zu kennen.
#Kreisau_liest #Kreisau_empfiehlt
(…) Verletzlichkeit ist die Leitvokabel der neuen Normalität. Hinter der medizinisch virulenten Frage, wer zu den Verwundbaren, den Vulnerablen, zählt, setzt sich der sozialpolitische Verteilungskampf fort. Der Soziologe Stephan Lessenich, Autor des Buches „Grenzen der Demokratie – Teilhabe als Verteilungsproblem“, beschreibt die Lage wie folgt: „Souverän ist heute, wer über den Verwundbarkeitszustand entscheidet. Und das sind nicht die Verletzlichen selbst.“
Weiterlesen: Lesenswert. Der Wochenrückblick #14 | #Kreisau_liest #Kreisau_empfiehlt
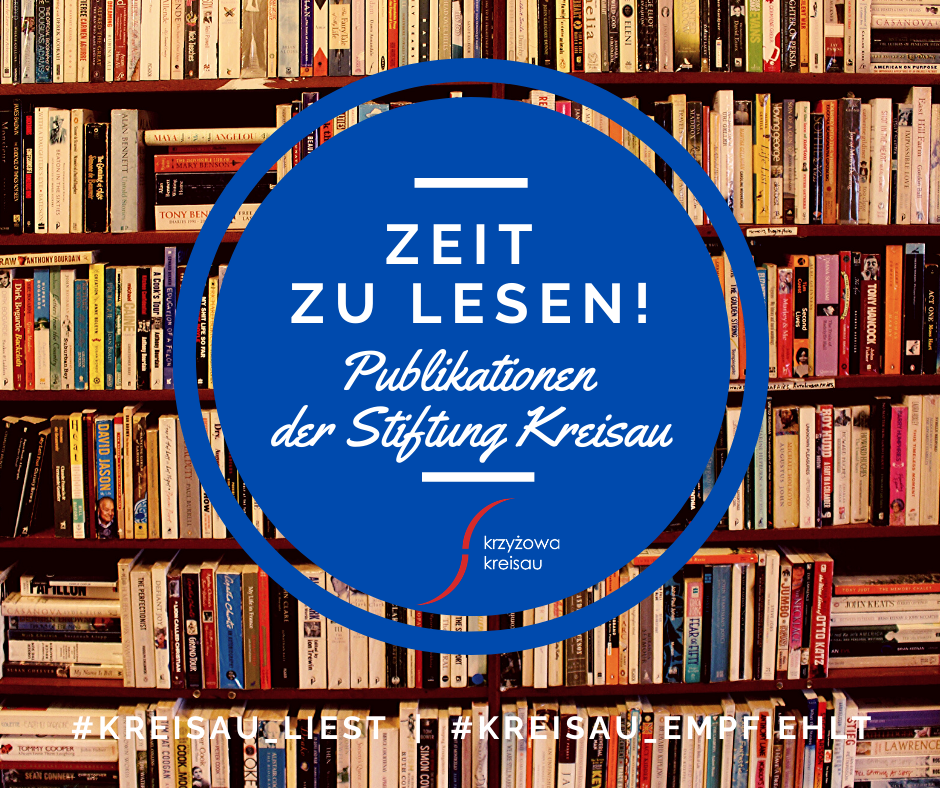
In dieser Woche möchten wir Ihnen einen Text von Dr. Robert Żurek empfehlen. Darin schildert der Autor nicht nur die nach 1945 von der Katholischen und der Evangelischen Kirche unternommenen Bemühungen um die deutsch-polnische Aussöhnung, sondern stellt auch die Frage, welche Schlussfolgerungen sich aus diesem Prozess für das heutige Europa ziehen lassen.
Mit diesem Beitrag beenden wir unsere allwöchentliche Reihe „Zeit zu lesen! Publikationen der Stiftung Kreisau!“ („To warto przeczytać. Publikacje z Krzyżowej”). Wir bedanken uns für das bisherige Interesse an den von der Stiftung Kreisau herausgegebenen Publikationen, die wir hier in den vergangenen Monaten popularisieren durften.
Wir laden Sie zugleich recht herzlich dazu ein, unsere Internetseite und unser Facebook-Profil zu besuchen. Wir werden Sie dort weiterhin auf spannende Texte und Veranstaltungen zur Geschichte Europas sowie zu den deutsch-polnischen Beziehungen aufmerksam machen.
#Kreisau_liest #Kreisau_empfiehlt
Weiterlesen: Zeit zu lesen! Publikationen der Stiftung Kreisau! #17
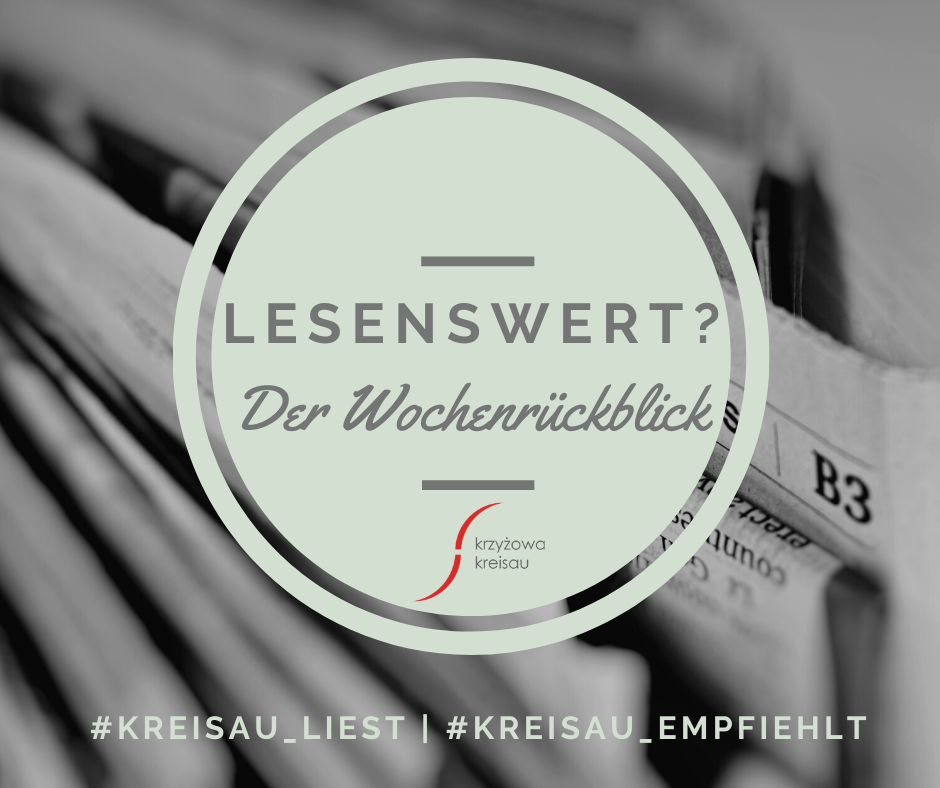 Herzlich laden wir Sie zur Lektüre unserer subjektiven Presseschau ein. Die Artikel sind in den vergangenen Tagen erschienen und wir hoffen, dass sie für Sie interessant oder überraschend sind oder auch zu Diskussion und Widerspruch anregen.
Herzlich laden wir Sie zur Lektüre unserer subjektiven Presseschau ein. Die Artikel sind in den vergangenen Tagen erschienen und wir hoffen, dass sie für Sie interessant oder überraschend sind oder auch zu Diskussion und Widerspruch anregen.
Es geht nicht darum, mit allen versammelten Ansichten übereinzustimmen sondern darum, bewußt wahrzunehmen, wie die uns umgebende Wirklichkeit von anderen gesehen wird. Es lohnt sich, mehr als eine Perspektive zu kennen.
#Kreisau_liest #Kreisau_empfiehlt
(…) Die vier Tage des Sondergipfels der EU verliefen zäh. Am Ende steht aber eine belastbare Vereinbarung. Und darauf kommt es an. Verglichen mit anderen Suchen nach Kompromissen in der EU waren die Haushaltsverhandlungen diesmal sogar blitzartig schnell. Nur drei Monate haben sie - von der Corona-Krise getrieben - gedauert, von der Vorlage des Aufbaufonds bis zum Beschluss heute früh.
Weiterlesen: Lesenswert. Der Wochenrückblick #13 | #Kreisau_liest #Kreisau_empfiehlt